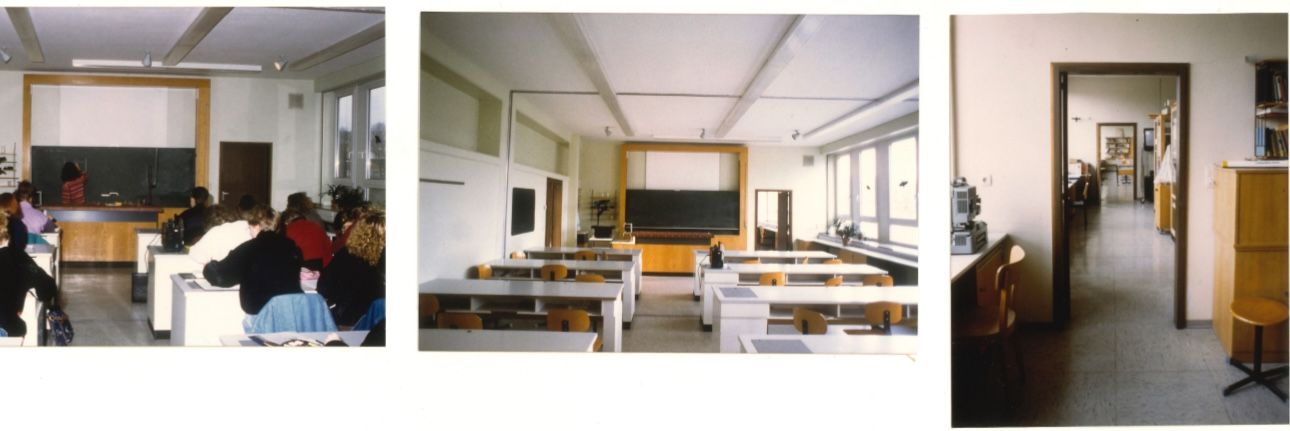Zu Beginn unseres Projekts formulierten wir ein Erkenntnisinteresse und stellten uns die Leitfrage: „Inwiefern sorgte eine Geschlechtertrennung für Grenzen und Möglichkeiten in der Bildung?“
Die Geschlechtertrennung in der Bildung hat sowohl Grenzen als auch Möglichkeiten geschaffen, wie das Beispiel unserer Schule, des Liebfrauengymnasiums Büren (LFG) eindrücklich zeigt. Ursprünglich als reine Mädchenschule im Jahr 1946 gegründet, spiegelt das LFG die historische Entwicklung wider, bei der Mädchen und Jungen getrennt unterrichtet wurden.
Die Trennung der Geschlechter am LFG führte zu Bildungsgrenzen für Mädchen. Bis in die 1970er Jahre hinein wurden sie auf traditionelle Rollen als Hausfrau und Mutter vorbereitet, was sich in der Wahl des „hauswirtschaftlichen Zweigs“ widerspiegelte, der als „Puddingabitur“ bekannt war. Diese einseitige Bildungsorientierung hinderte Mädchen daran, gleiche Chancen wie Jungen in akademischen und beruflichen Feldern zu erhalten. Die strikte Regulierung des Schulalltags stellte eine weitere Grenze dar. Schülerinnen mussten Röcke tragen, wurden von den Schwestern kontrolliert und durften nicht mit Jungen interagieren wie sich aus den Interviews mit ehemaligen Schülerinnen zeigt. Diese Regeln begrenzten die soziale Entwicklung der Mädchen und erschwerten ihnen den späteren Umgang in gemischten sozialen und beruflichen Umgebungen.
Trotz dieser Grenzen bot die Geschlechtertrennung auch Chancen. Aus den Gesprächen mit den ehemaligen Schülerinnen wurde deutlich, dass die Jungen an der Schule nicht vermisst wurden, da die Mädchen es nicht anders kannten. Die Schule wurde als fürsorglich beschrieben und ermöglichte es allen Schülerinnen, in einem geschützten Umfeld zu lernen – wovon später auch die Jungen profitierten. Zwar schränkten die strengen, aber gut gemeinten Regeln die Schülerinnen in einigen Bereichen ein, gleichzeitig trugen sie jedoch auch zu ihrer positiven Entwicklung bei.
Ein Vorteil der Geschlechtertrennung zeigte sich insbesondere im Sportunterricht, da die Konkurrenz ohne Jungen als angenehmer empfunden wurde. Auch in den Naturwissenschaften berichteten die Schülerinnen von einem gestärkten Selbstbewusstsein. Der persönliche Umgang mit den Lehrkräften und die Fürsorge der Schwestern boten den Schülerinnen zudem emotionale Unterstützung und ein Gefühl von Sicherheit, welches sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stärkte.
Mit der Aufnahme von Jungen im Jahr 1971 und der schrittweisen Einführung des gemischten Unterrichts am LFG begann der Wandel zu einer koedukativen Schule. Dieser Übergang ermöglichte es, geschlechterbasierte Bildungsgrenzen aufzuheben und gleiche Bildungszugänge für beide Geschlechter zu schaffen. Ehemalige Schülerinnen berichteten, dass die gemischten Klassen zu einer entspannteren Lernatmosphäre führten und die sozialen Kompetenzen stärkten.
Aus heutiger Sicht bietet der gemeinsame Unterricht den Vorteil, unterschiedliche Perspektiven auf bestimmte Themen kennenzulernen. Die Qualität des Unterrichts blieb laut den befragten Schülerinnen unverändert. Auch nach unseren eigenen Erfahrungen profitieren wir mehr von der gemeinsamen Diskussion und dem Austausch, als dass wir uns im Unterricht gestört fühlen. Im späteren Berufsleben existiert ebenfalls keine Geschlechtertrennung, und es wird häufig als Vorteil gesehen, verschiedene Sichtweisen einzubeziehen.
Abschließend lässt sich zu Beantwortung der Leitfrage sagen, dass die Geschlechtertrennung am LFG Büren sowohl Grenzen als auch Möglichkeiten in der Bildung schuf. Während sie Mädchen lange Zeit auf traditionelle Rollen beschränkte und ihnen den Zugang zu höherer Bildung erschwerte, bot sie gleichzeitig eine sichere Lernumgebung, in der sie sich ohne sozialen Druck entfalten konnten. Geschlechtertrennung wurde vor allem im Sportunterricht als Vorteil empfunden, da sich einige Schülerinnen ohne Jungen mutiger fühlten. Die Qualität des Unterrichts blieb jedoch unabhängig von der Geschlechtertrennung, weshalb aus damaliger Perspektive kaum von einer Einschränkung gesprochen werden kann.
Der Übergang zur Koedukation markiert jedoch einen entscheidenden Schritt in Richtung Gleichberechtigung und Chancengleichheit. Heute profitieren Schülerinnen und Schüler gleichermaßen von einer Bildung, die es ihnen ermöglicht, ihre individuellen Potenziale unabhängig vom Geschlecht zu entfalten.
Diese Reflexion zeigt, dass die Geschlechtertrennung im Bildungssystem sowohl einschränkend als auch befreiend wirken kann und dass die Umstellung auf koedukative Systeme eine Bereicherung für alle darstellt. Aus heutiger Sicht ist der gemeinsame Unterricht als Chance zu betrachten, da er in einer offenen Gesellschaft dazu beiträgt, verschiedene Perspektiven zu hören und auf dem Arbeitsmarkt geschlechterübergreifende Zusammenarbeit fördert.